Wie entsteht die Erkrankung und was passiert im Körper?
Als Stoffwechselorgan erfüllt die Leber lebenswichtige Aufgaben und dient gleichzeitig als Entgiftungsorgan des Körpers. Bei einer Leberzirrhose wird das Lebergewebe durch narbenartiges Bindegewebe ersetzt, so dass sie ihre Funktion nicht mehr ausüben kann. Im fortgeschrittenen Stadium können weiterführende Komplikationen wie lebensbedrohliche Krampfaderblutungen an der Speiseröhre (Ösophagusvarizen), Bauchwassersucht (Aszites) oder auch Leberzellkrebs verursacht werden.
Symptome
Häufig zeigen sich in frühen Stadien der Leberzirrhose keine oder nur geringe Symptome. Im späteren Verlauf kann es durch die zunehmende Vernarbung der Leber zu einer Erhöhung des venösen Blutdrucks im Bauchraum kommen. Dies kann zur Ausbildung von Krampfadern in Magen und Speiseröhre (Ösophagusvarizen) führen. Diese können Blutungen verursachen, bis hin zu lebensgefährlichem Blutverlust. Außerdem können Wasseransammlungen im Bauch (Aszites) auftreten, die Schwellungen, Druckgefühl und Ernährungsprobleme mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität nach sich ziehen können.
Sollte es zum Auftreten von Leberkrebs (hepatocelluläres Karzinom, HCC) kommen, so verursacht dieses oft zunächst keine Symptome. In späteren Stadien kann das HCC zu Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust sowie Symptomen durch den raumfordernd wachsenden Tumor bis hin zu Blutungen führen.
Ursachen
Die Ursache für eine Leberzirrhose kann eine chronische Viruserkrankung (Hepatitis), oder akute Leberschädigungen (etwa durch Gifte) sein. Sie kann aber auch durch übermäßigen Alkoholkonsum entstehen.
Diagnostik
Die Leberzirrhose wird durch eine Kombination aus bildgebenden Verfahren, wie Ultraschall/Steifigkeitsmessung, bei Bedarf CT und MRT und klinischen sowie Laborparametern festgestellt.
Möglicherweise entstehende Lebertumoren können mittels CT, MRT und Ultraschall diagnostiziert werden.
Behandlung des Pfortaderhochdrucks
Bei einer Leberzirrhose steigt der Druck in der Pfortader an. Ein sogenannter TIPS (Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt) schafft einen Umgehungskreislauf und senkt so den Druck. Dadurch wird das Risiko von Komplikationen, wie potentiell lebensbedrohliche Blutungen verringert. Auftretendes Bauchwasser (Aszites) kann durch einen TIPS wirkungsvoll therapiert werden.
Der TIPS wird in einer etwa 90-minütigen Operation eingesetzt, meist unter Vollnarkose. Über einen kleinen Zugang an der rechten Halsvene wird ein dünner Schlauch (Silikonkatheter) unter Röntgenkontrolle bis in eine Lebervene geführt. Mit Ultraschall wird dann ein Ast der Pfortader punktiert. Anschließend wird ein Draht und ein Ballon eingeführt, um einen neuen Verbindungskanal (Shunt) in der Leber zu schaffen. Damit dieser offen bleibt, wird ein Gefäßstützgerüst (Stent) eingesetzt.
Behandlung von Leberkrebs
Die Therapie des Leberkrebses oder HCC kann in Abhängigkeit des Stadiums operativ, minimal-invasiv oder medikamentös erfolgen. In vielen Fällen ist eine Behandlung mittels Ablation möglich. Hierbei werden kleine Sonden in den Tumor eingeführt und dieser auf über 90 Grad erhitzt und so „verödet“. Eine Operation wird dadurch vermieden, was zu einer schnelleren Genesung führt.
Wir führen Ablationen in Vollnarkose und unter CT- und Ultraschall-Steuerung durch. Dabei stehen uns die modernsten Ablationstechniken wie Mikrowellenablation, Radiofrequenzablation, Kryoablation und die irreversible Elektroporation zur Verfügung.
In fortgeschritteneren Tumorstadien ist die transarterielle Chemoembolisation (TACE) empfohlen, welche wir mit modernsten Geräten angiografisch kontrolliert durchführen.

Beratung zu Ablation und Embolisation
Sowohl die Ablation als auch die Embolisation können auch für Lebermetastasen durchgeführt werden. Auch in anderen Organen wie Niere, Lunge und Knochen können diese Techniken angewandt werden. Wünschen Sie eine entsprechende Beratung?
Ihre Experten

PD Dr. med. Kornelius Schulze
Chefarzt
Gastroenterologie, Hämatologie, Onkologie
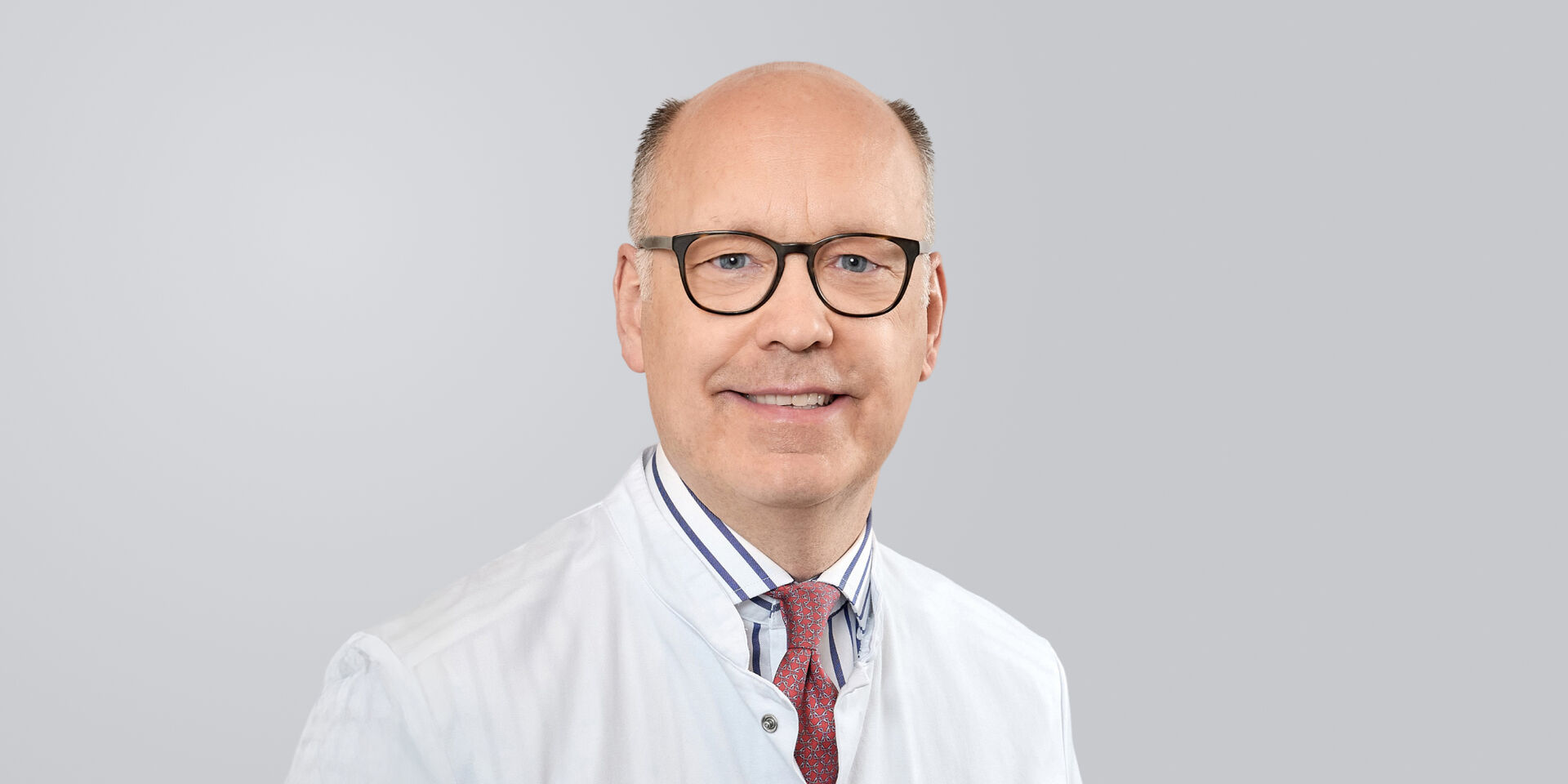
Prof. Dr. med. Christian R. Habermann
Chefarzt
Diagnostische Radiologie, Interventionelle Radiologie

Dr. med. Nando Mertineit
Leitender Oberarzt
Interventionelle Radiologie
Das könnte Sie auch interessieren

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
In unserer Radiologie versorgen wir stationäre und ambulante Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen. Dabei setzen wir auf modernste Bildgebungsverfahren.
