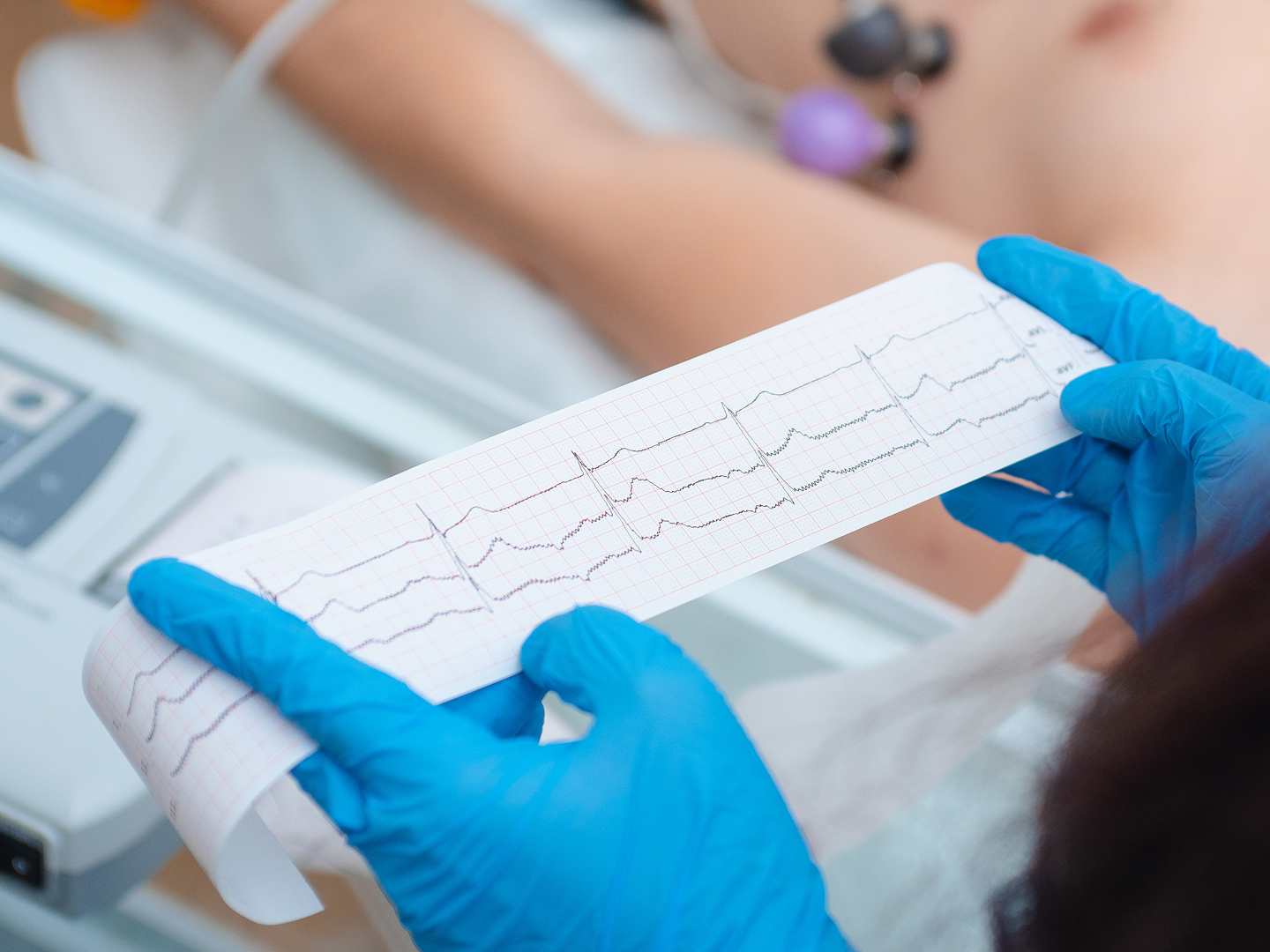Das Herz wieder in Takt bringen
Bei Herzrhythmusstörungen durch krankhafte Veränderungen des Reizbildungs- oder Reizleitungssystems ist die Übertragung des elektrischen Impulses zum Herzmuskel gestört. Es können erhebliche Beschwerden wie Schwindelgefühl, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Herzklopfen oder Bewusstlosigkeit auftreten. Ein zu langsamer Herzschlag oder übermäßig lange Pausen zwischen den Herzschlägen können in schweren Fällen sogar lebensbedrohlich werden.
Ursachen
Ein langsamer Herzschlag kann verschiedene Ursachen haben. Bei einem „Sinusknotensyndrom“ gibt der Sinusknoten, der Taktgeber des Herzens, seltener elektrische Impulse ab. Dadurch sinkt die Herzfrequenz und der Herzschlag wird langsamer. Häufig fehlt dann auch die normalerweise unter Belastung ansteigende Herzschlag. Das heißt, der Mensch ist beim Sport nicht mehr so belastbar. Eine andere Ursache ist, dass der Impuls des Vorhofs nicht mehr auf die Herzkammern übergeleitet wird. Der Herzschlag wird dann zu langsam oder bleibt ganz aus.

Diagnostik und Behandlung
Die Diagnose wird in der Regel durch ein Elektrokardiogramm (EKG) oder Langzeit-EKG gestellt. In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, einen Ereignisrekorder zu implantieren, um nur selten auftretende Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Je nach Diagnose leitet Ihre Kardiologin oder Ihr Kardiologe eine entsprechende Therapie ein.
1. Herzschrittmacher
Zur Behandlung von Rhythmusstörungen, die mit einem langsamen Herzschlag einhergehen, kann es notwendig sein, einen Herzschrittmacher zu implantieren. Er kann den Herzrhythmus wahrnehmen und bei Bedarf seine eigenen elektrischen Impulse abgeben, damit das Herz regelmäßig und rechtzeitig schlägt. Das Gerät erkennt also, ob das Herz von alleine schlägt oder ob ein Impuls vom Schrittmacher benötigt wird.
Dies bleibt in aller Regel vom Patienten völlig unbemerkt, da hierfür nur ein sehr schwacher elektrischer Strom benötigt wird. Bei einigen Herzschrittmachern ist auch die Wahrnehmung der körperlichen Aktivität möglich und sinnvoll, so dass sie frequenzreguliert arbeiten können. So kann der Schrittmacher bei Bedarf die Herzfrequenz entsprechend beschleunigen, wenn die Patientin oder der Patient aktiver wird, oder verlangsamen, wenn sie oder er ruht.
2. Implantation von Defibrillatoren
Treten schnelle Herzrhythmusstörungen wie Kammerflattern oder -flimmern auf, ist eine möglichst frühzeitige Behandlung besonders wichtig. Dabei spielt die Defibrillation eine entscheidende Rolle und kann lebensrettend sein. Ähnlich wie ein Herzschrittmacher wird der etwas größere Defibrillator in einem kleinen Eingriff unter örtlicher Betäubung unter der Haut bzw. unter den Brustmuskel implantiert. Er kann ebenso kontinuierlich die Herzaktion überwachen und eingreifen, wenn Rhythmusstörungen auftreten.
Das Haupt-Unterscheidungsmerkmal zum Schrittmacher, der nur bei langsamen Rhythmusstörungen eingreift, ist die Möglichkeit, auch bei schnellen gefährlichen Rhythmusstörungen wie Kammerflattern oder -flimmern und dem damit verbundenen Pulsabfall Elektroschocks (Defibrillation) abzugeben und den Herzrhythmus wieder zu normalisieren.
3. Kardiale Resychronisations-Therapie (CRT)
Die CRT ist eine Behandlungsmöglichkeit für Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche und asynchronem Herzschlag der Herzhauptkammern. Die Indikationsstellung erfolgt in aller Regel nach Bestätigung der Herzmuskelschwäche über ein Elektrokardiogramm (EKG), eine Herzechokardiografie oder ein Kardio-MRT.
Ein CRT-Gerät sendet Impulse an beide Herzhauptkammern, damit diese wieder gleichzeitig – also synchron – schlagen. Dies kann die Pumpleistung des Herzens verbessern. In den meisten Fällen wird diese Therapie mit einem implantierbaren Cardioverter-Defibrillator (ICD) kombiniert. Durch den Einsatz spezieller Herzschrittmacher und Defibrillatoren kann das Pumpen der verschiedenen Anteile des Herzens besser synchronisiert werden. Grundvoraussetzung hierfür sind spezielle Formen der Herzschwäche, bei denen die Herzwände noch intakt sind, die Pumpleistung aber dadurch herabgesetzt ist, dass sich die Herzwände nicht gleichzeitig kontrahieren.
4. Implantierbare Ereignisrekorder (ILR)
Um abklären zu können, welche Relevanz die Herzrhythmusstörungen, die eine Patientin oder ein Patient beschreibt, für seine Gesundheit haben, wird oftmals eine 24 Stunden-Langzeit-EKG-Aufzeichnung gestartet. Sollte diese den Grund nicht klar aufzeigen, kann es sinnvoll sein, mit Hilfe eines implantierbaren Rhythmusrekorders auf Ursachensuche zu gehen. Diese auch Loop Recorder genannten Geräte sind meist kleine, unter die Haut implantierbare Geräte, die im Fall einer Synkope oder Rhythmusstörung vom Arzt ausgelesen werden können.
Dazu wird in einem unkomplizierten Eingriff unter örtlicher Betäubung ein kleiner Hautschnitt im Bereich des seitlichen Brustmuskels gesetzt und das Gerät, von der Größe etwa mit einem USB-Stick vergleichbar, unter die Haut implantiert. Dort kann es bis zu drei Jahre lang verbleiben und den Herzrhythmus und etwaige Auffälligkeiten kontinuierlich aufzeichnen.
5. Verödung von Rhythmusstörungen (Katheterablation)
Störende elektrische Signale im Herzen können gezielt ausgeschaltet werden. So lässt sich z. B. Vorhofflimmern dauerhaft beseitigen.
6. Analyse elektrischer Herzaktivität (EPU)
Bei dieser Untersuchung analysieren wir mit feinen Kathetern die Erregungsleitung im Herzen, um die Ursache für Rhythmusstörungen zu finden.
Ihre Expertinnen und Experten


Das könnte Sie auch interessieren

Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Intensivmedizin
Lungen-, Herz- und Gefäßerkrankungen hängen oft miteinander zusammen. In unserer Klinik im Marienkrankenhaus Hamburg finden Sie Spezialistinnen und Spezialisten aus diesen sich ergänzenden Fachbereichen – für eine optimale Behandlung.

Unser Pflegekonzept
Die Qualität der Pflege hat im Marienkrankenhaus Hamburg einen hohen Stellenwert. Unsere Pflegefachkräfte versorgen Patientinnen und Patienten nicht nur kompetent, sondern auch mit Verständnis und Mitgefühl.